Gemeinsam mit den Unternehmern Dominik Lorenzen und André Mücke habe ich einen Gastbeitrag zu den Corona-Hilfen des Bundes geschrieben, der gestern im Hamburger Abendblatt auf Seite 2 erschienen ist. Wir hoffen, damit eine konstruktive Diskussion anzustoßen!
Sie können hier unsere etwas erklärendere Version und unter diesem Link die Abendblatt-Version lesen.
„Steckt die Bazooka endlich weg“: Gerechte Corona-Hilfen für Unternehmen
Es gehört wohl zum Einmaleins des Amtes, wenn ein Wirtschaftsminister zu Beginn einer nie dagewesenen Krise sagt, in Deutschland solle kein Unternehmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie pleitegehen. Dieser Satz, den Peter Altmaier sinngemäß im März von sich gab, war gut gemeint, aus heutiger Sicht aber leider falsch. Denn seitdem hat die Bundesregierung zahlreiche Hilfsprogramme mit gutgemeinten politischen Botschaften als Begleitmusik aufgelegt. „Soforthilfen“ lassen keinen Zweifel an ihrer Unmittelbarkeit; „Überbrückungsgeld“ klingt beruhigend und impliziert, dass nach dem zu überbrückenden Zeitraum alles so weiterläuft wie vor der Krise; die „Novemberhilfe“ suggeriert, dass der Spuk nach einem Monat wieder vorbei ist. Diese Rhetorik kommt allerdings dann an ihre Grenzen, wenn von „Überbrückungshilfe II“ (oder III) und den „Dezemberhilfen“ die Rede ist.
Zunächst möchten wir festhalten: Die aktuellen Wirtschaftshilfen sind keine Almosen für Unternehmer*innen. Es handelt sich um Menschen, die etwas bewegen – und sich nicht abhängig machen wollen. In der aktuellen Situation muss der Staat die wirtschaftliche Aktivität drastisch einschränken, und gleichzeitig verhindern, dass dadurch Strukturen kaputt gehen, die wir in Zukunft brauchen. Die gigantische Mobilisierung von Geld dient dazu, Arbeitsplätze zu erhalten, wirtschaftliche Wertschöpfung zu bewahren und damit die Steuereinnahmen von morgen zu sichern. Das ist uneingeschränkt richtig, auch wenn dabei leider nicht genug in Richtung einer klimagerechten Transformation gesteuert wird.
Dagegen steht, dass der Unmut bei Unternehmer*innen und Selbständigen mit jedem Tag wächst. Das Gefühl macht sich breit, der Staat handle nicht gerecht, seine Entscheidungen basierten mehr auf Willkür und Spontaneität als auf durchdachter Planung. Und das ist fatal für das Vertrauen in staatliches Handeln – auf zwei Ebenen.
Erstens sehen wir bereits jetzt, dass das lautstarke Buhlen um Soforthilfen unter den einzelnen Wirtschaftsbranchen in vollem Gang ist. Das ist bei der jetzigen Kakofonie der Hilfen verständlich, aber auf keinen Fall zielführend. Denn es nährt den fatalen Eindruck, dass, wer am lautesten schreit und am besten vernetzt ist, die anderen im Rennen um staatliche Hilfsgelder abhängt. Dabei geht es doch eigentlich darum, dass die Verbände mehr gemeinsam als gegeneinander mit dem Staat um die richtige Ausgestaltung der Hilfen ringen. Es darf mithin keine Rolle spielen, ob jemand Verluste macht, weil eine Verordnung die unmittelbare Schließung der Ladenfläche bedeutet oder das Geschäft aus anderen Corona-induzierten Gründen zusammenbricht.
Zweitens ist das Vertrauen gesunken, dass die Hilfen einfach und gerecht beantragt und zugesprochen werden. Ein Beispiel: Die Soforthilfen, für die Unternehmer*innen ihre Bedürftigkeit nachweisen müssen. Neben individueller Betroffenheit war ein Liquiditätsengpass nachzuweisen. Ein Schlag ins Gesicht für alle, die artig Rücklagen in ihren Firmen gebildet hatten. Wer seine Gewinne aus Vorjahren im Unternehmen belassen hatte, hat kein Anrecht auf Hilfe. Wer seine Gewinne jedoch ausgeschüttet und privat geparkt oder ausgegeben hatte, bekommt Hilfe. Noch ein Beispiel: Beim ersten Überbrückungsgeld war das Kleingedruckte so umfangreich geraten, dass kaum jemand herausfand, wer antragsberechtigt war. Die Idee, tatsächlich angefallene Kosten zu ersetzen, war gar nicht schlecht.
Aber mit starren Grenzen festzulegen, welcher Umsatzverlust notwendig ist, um Hilfen zu erhalten, führt zu absurden Ungerechtigkeiten. So liegt die derzeitige Grenze, oberhalb derer Unternehmer*innen keine Unterstützung mehr bekommen, bei 30 Prozent Umsatzverlust. Handelsunternehmen mit hohen Umsätzen und hohen Fixkosten können aber schon bei 10 Prozent Umsatzverlust in kürzester Zeit in die Insolvenz gezwungen werden. Geschäftskonzepte mit einem hohen Anteil variabler Kosten können hingegen auch noch mit 50 Prozent Umsatzverlust profitabel sein. Durch die Hamburger Medien ging der Fall einer Eventagentur, die mit einem Autokino die Flucht nach vorne antrat, ihre Umsatzverluste reduzierte, dadurch aber den Anspruch auf Hilfe verlor. Überbrückungsgeld wurde so zur Strafgebühr für alle, die für sich und unsere Wirtschaft versuchten, Wertschöpfung zu erhalten. Noch schwieriger wurde es mit der Ankündigung des Bundesfinanzministeriums, Umsätze (nicht nur Fixkosten) für den November zu erstatten. Lassen wir kurz beiseite, dass diese Novemberhilfen vielleicht erst im Januar ausgezahlt werden. Es geht um mehr – um konkrete Ungerechtigkeiten. Denn: Wer letztes Jahr im November ordentlich Umsatz, aber in diesem Corona-November wenig Fixkosten hatte, kann sich über einen ordentlichen Sondergewinn freuen. Glücklicherweise hat das Finanzministerium nun nachgebessert und ermöglicht, den durchschnittlichen Umsatz des Gesamtjahres 2019 als Referenz zu nehmen. Das grundsätzliche Problem bleibt jedoch bestehen.
2020 ist nun zu Ende, aber ein Rückblick ist aufschlussreich, um zu sehen, wo die Stolpersteine lagen, wo es besser hätte laufen müssen. Corona wird unser Leben und unsere Wirtschaft auch noch nächstes Jahr stark beschäftigen und unsere Gesellschaft noch weit darüber hinaus. Was wir jetzt dringend brauchen, ist eine Leitidee für 2021.
Unser Vorschlag: Der Maßstab für alle nicht rückzahlbaren Zuschüsse muss die Verlustminderung über das gesamte Wirtschaftsjahr sein – nicht Umsatz oder Fixkosten. Denn Umsatz- und Kostenkurven über das Jahr gehen in jeder Branche und von Firma zu Firma weit auseinander. Der Verlust aber ist ein gerechter Indikator. Er belohnt diejenigen, die Hilfe brauchen UND sich mit kreativen Ideen gegen den Abschwung stemmen. Wer etwas unternimmt und sich, der Wirtschaft und der Gesellschaft hilft, dem wird geholfen. Das wäre Hilfe mit Vernunft und Verstand – statt mit Bazooka und Bingo.
Auch braucht es klare politische Vorgaben und weiche Übergänge statt harter Grenzen: Je größer die Firma (nach Anzahl der Beschäftigten) desto geringer die Unterstützung. Jede Firma muss im Rahmen des unternehmerischen Risikos ständig mit kleinen und großen Katastrophen umgehen. Dafür wurden Rücklagen gebildet oder dafür wird Kapital aufgenommen. Große Firmen können das leichter als kleine.
Der Bund sollte die Jahresverluste also je höher ausgleichen desto kleiner die Firma ist. Soloselbstständige könnten in dieser Rechnung einen pauschalen Unternehmerlohn einrechnen. Die maximale Förderung könnte zum Beispiel bei 75 Prozent des Jahresverlustes liegen. Der Anreiz, Verluste zu minimieren, sollte mithin maximal groß sein. Nur so können wir für möglichst wenig neue Schulden viele Betriebe erhalten und damit die Steuereinnahmen von morgen sichern.Ausnahmen braucht es nur dort, wo wir öffentliche, zum Beispiel kulturelle und soziale Infrastruktur erhalten wollen. Teile des Kulturbetriebs und des Bildungsbereichs funktionieren eben nicht nach einer rein marktwirtschaftlichen Logik. Hier ist insbesondere der Staat auf allen Ebenen gefordert, seiner Verpflichtung zur Gewährleistung der sozialen Daseinsvorsorge nachzukommen.
Es braucht zudem auch eine mittel- und langfristige (Re-)Finanzierungsstrategie der Corona-Maßnahmen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Denn jetzt, ganz sofort, bei den Hilfen, da sollten wir es endlich richtig machen und anstelle politischer Botschaften funktionierende und wirksame Konzepte anbieten – Konzepte, die gerecht sind und unternehmerisches Handeln belohnen.“
Die Autor*innen:

Dominik Lorenzen, Unternehmer, Fraktionsvorsitzender der Grünen Bürgerschaftsfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft

Katharina Beck, Senior Manager in einer internationalen Unternehmensberatung, Bewerberin für die Spitzenkandidatur der Hamburger Grünen für die Bundestageswahl 2021

André Mücke, Unternehmer, ehem. Vize-Präses der Handelskammer Hamburg
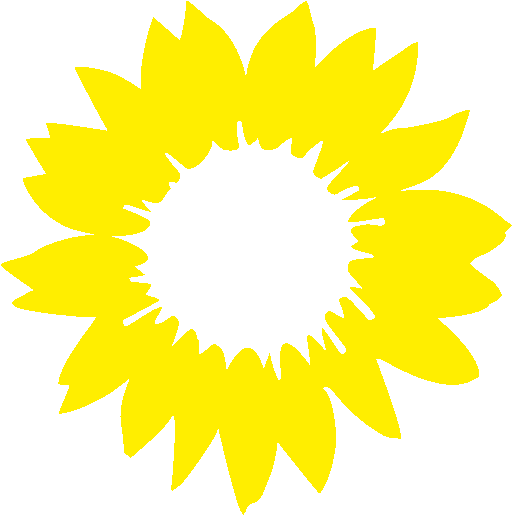
Neuste Artikel
Persönliche Erklärung gemäß § 31 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags zum „Sicherheitspaket“ – 18.10.2024
Zu meiner persönlichen Erklärung nach § 31 GO BT zur zweiten und dritten Beratung des von den Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung der Terrorismusbekämpfung sowie zur zweiten und dritten Beratung des von den Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems.
Generationenkapital generationengerecht anlegen! – 27.09.2024
Die Innovation, die wir im Rentenpaket II mit dem Generationenkapital auf den Weg bringen – das ist keine Kleinigkeit, sondern eine große, wichtige Innovation. Wir nehmen bis zu 200 Milliarden Euro auf, um die Beitragszahler*innen in Zukunft zu entlasten.
Ich frage mich allerdings ernsthaft: Warum ist es nicht selbstverständlich, wenn es um Generationengerechtigkeit geht, dass wir das Geld auch generationengerecht anlegen. Dabei geht es um Nachhaltigkeit.
Deswegen fordere ich dazu auf, dass wir die Frage, ob wir den eingeschlagenen Weg nicht ändern sollten, in künftigen Debatten erneut aufwerfen. Mehr dazu in meiner Rede!
Rede zur Widersprüchlichkeit der AfD – 26.09.2024
Die Ampel handelt: Wir werden mit der Wachstumsinitiative, den geplanten 49 Maßnahmen (unteranderem Steuerentlastungen in Höhe von 21 Milliarden Euro) die deutsche Wirtschaft und das Wachstum stark unterstützen.
Die Widersprüchlichkeit der AfD ist derweil kaum zu ertragen: Sie fordert niedrige Strompreise aber will die nachgewiesenermaßen teuerste Stromquelle (Atom) reaktivieren und uns wieder von Autokraten und deren Gas und Öl abhängig machen.
Und Björn Höcke von der AfD fällt nichts anderes ein, als den Unternehmen, die sich für Vielfalt aussprechen, schwere wirtschaftliche Turbulenzen zu wünschen.
Ähnliche Artikel
Presse
„Ich habe total Bock auf den Job!“
Die Hamburger Morgenpost berichtet über meine Bewerbung als Spitzenkandidatin der Hamburger GRÜNEN für die Bundestagswahl 2021. Lesen Sie das passende Portrait entweder im Foto oder online auf der MOPO Seite unter https://www.mopo.de/hamburg/politik/-ich-habe-bock-auf-den-job–diese-hamburgerin-will-als-gruenen-spitze-in-den-bundestag-37539682